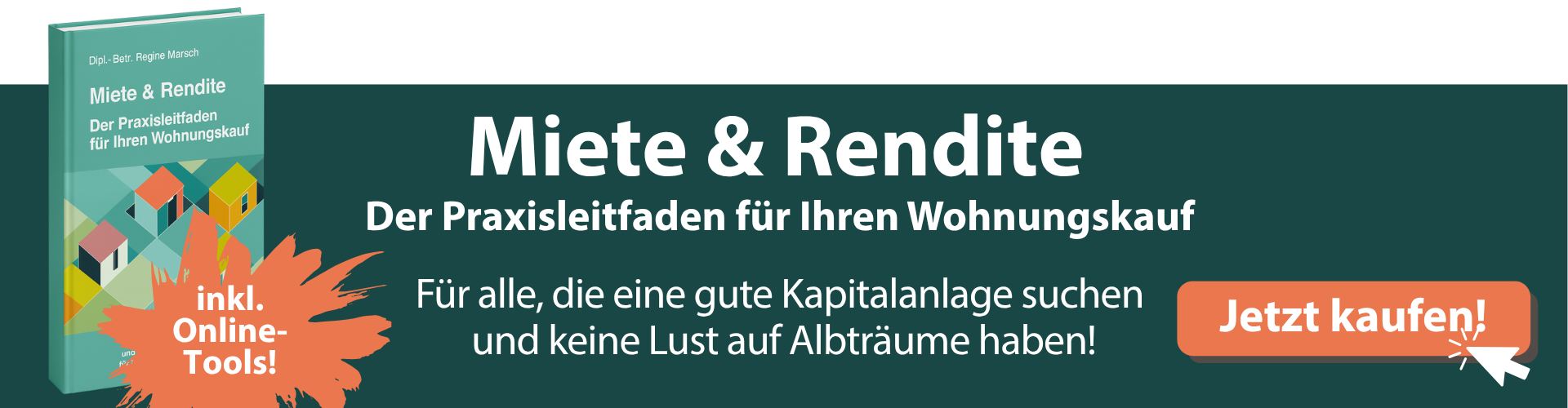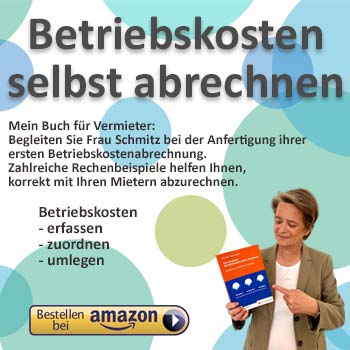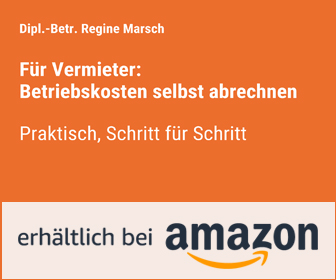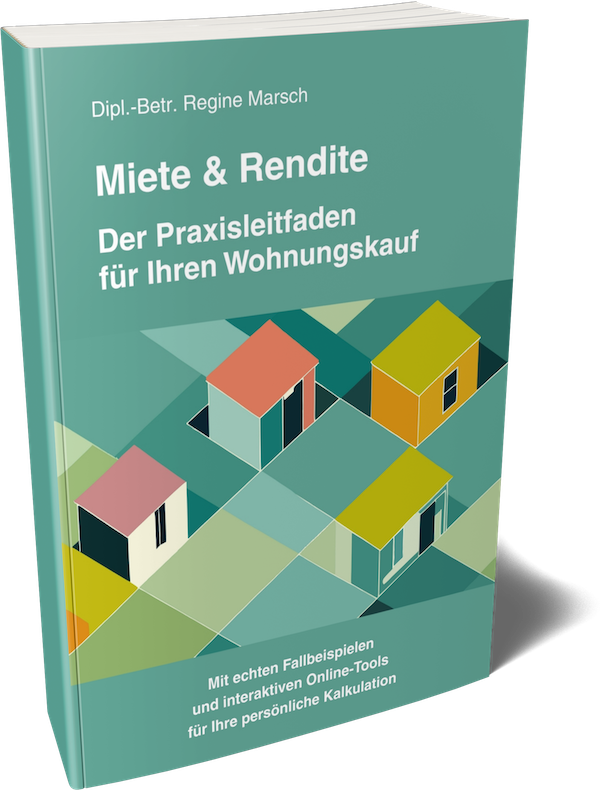Bild: freepik.com/freepikDie Kombination aus Wärmepumpe und klassischem Heizkörper ist in vielen Bestandsimmobilien gängige Praxis. Damit diese Heizlösung effizient arbeitet und den energetischen Anforderungen entspricht, ist eine korrekte Einstellung der Heizkörper erforderlich. Vermieter und Hausverwalter stehen dabei vor der Aufgabe, sowohl die technische Funktionalität sicherzustellen als auch die Heizkostenabrechnung korrekt zu gestalten.
Bild: freepik.com/freepikDie Kombination aus Wärmepumpe und klassischem Heizkörper ist in vielen Bestandsimmobilien gängige Praxis. Damit diese Heizlösung effizient arbeitet und den energetischen Anforderungen entspricht, ist eine korrekte Einstellung der Heizkörper erforderlich. Vermieter und Hausverwalter stehen dabei vor der Aufgabe, sowohl die technische Funktionalität sicherzustellen als auch die Heizkostenabrechnung korrekt zu gestalten.
Individuelle Faktoren je nach Anlage
Die optimale Einstellung hängt stets von der Gebäudedämmung, der Heizlast, dem Nutzerverhalten und der Heizflächenauslegung ab. Eine Pauschaleinstellung ist nicht zielführend. Deshalb sollten die Parameter regelmäßig überprüft und auf aktuelle Gegebenheiten angepasst werden. Das gilt insbesondere nach baulichen Veränderungen wie Fenstertausch oder Dämmmaßnahmen.
Heizkörper auf Eignung prüfen und bei Bedarf austauschen
Wurde ein Gebäude auf eine Wärmepumpe umgestellt, sind typische Standardheizkörpern wie in älteren Gebäuden üblich oft zu klein dimensioniert. Ob ein Austausch erforderlich ist, hängt von der Fläche, der Bauart und dem Wärmebedarf der jeweiligen Räume ab. In Abhängigkeit von Faktoren wie möglicher Platz oder der Gebäudedämmung kann geprüft werden, welche Heizkörper für Wärmepumpen eingesetzt werden können.
Moderne Plattenheizkörper mit großer Oberfläche oder spezielle Niedertemperatur-Heizkörper eignen sich besonders gut. Alternativ lassen sich zusätzliche Heizflächen installieren oder punktuell durch Flächenheizungen ergänzen.
Für Vermieter empfiehlt sich eine Vor-Ort-Begehung durch einen Fachbetrieb. Dabei sollte die Heizleistung jedes Heizkörpers ermittelt und mit der Raumheizlast verglichen werden. So lassen sich Engpässe identifizieren und gezielt beheben.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur optimalen Einstellung
1. Niedrige Vorlauftemperaturen anpeilen
Wärmepumpen erreichen ihre höchste Effizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Je geringer die Differenz zwischen Umgebungstemperatur und Heizwassertemperatur, desto weniger Strom verbraucht das System. Ideal ist eine Vorlauftemperatur von maximal 55 Grad Celsius. In vielen Gebäuden reichen auch 35 bis 45 Grad aus, sofern die Heizkörper ausreichend groß dimensioniert sind.
2. Heizkurve einstellen
Die Heizkurve definiert, wie stark die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur steigt. Eine präzise Einstellung ist Voraussetzung für einen gleichmäßigen und sparsamen Heizbetrieb.
- Niveau der Heizkurve: Das Niveau bestimmt die Grundtemperatur, die das Heizwasser bei mittleren Außentemperaturen erreicht. Es sollte so gewählt werden, dass der gewünschte Raumkomfort eingehalten wird.
- Steilheit der Heizkurve: Die Steilheit legt fest, wie stark die Heiztemperatur bei sinkender Außentemperatur erhöht wird. Für Heizkörper sind höhere Steilheiten erforderlich als für Flächenheizungen. In unsanierten Altbauten kann eine Steilheit von 1,2 oder höher notwendig sein, während gut gedämmte Gebäude oft mit 0,8 bis 1,0 auskommen.
Die Anpassung erfolgt über den Regler der Wärmepumpe oder das zentrale Steuergerät. Vermieter sollten diese Einstellungen dokumentieren und bei veränderten Witterungsverhältnissen regelmäßig überprüfen lassen.
3. Keine Nachtabsenkung aktivieren
Im Unterschied zu konventionellen Heizsystemen reagieren Wärmepumpen träge auf Temperaturschwankungen. Eine starke Nachtabsenkung führt dazu, dass morgens hohe Heizleistungen erforderlich sind, um die Solltemperatur wieder zu erreichen. Dies verursacht unnötige Lastspitzen und erhöht den Stromverbrauch.
Effizienter ist ein durchgehender Betrieb mit konstanter Temperatur. Eine moderate Absenkung um ein bis zwei Grad ist möglich, sollte aber nicht automatisiert erfolgen. Die Abschaltung während der Nacht empfiehlt sich nicht, da sie den energetischen Vorteil der Wärmepumpe zunichtemacht.
Insgesamt gelten bestimmte Vorgaben für Wohnräume und die erforderlichen Temperaturen, die durch die Heizung erzielt werden müssen. Sie können als Orientierungswerte für die Einstellungen dienen.
4. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper im Gebäude die passende Wassermenge erhalten. Ohne diese Maßnahme fließt das Heizwasser bevorzugt durch kurze Leitungswege, während entferntere Räume unterversorgt bleiben.
Für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe hat ein solcher Abgleich einen großen Nutzen. Nur wenn die Wärmeverteilung ausgewogen ist, können niedrige Vorlauftemperaturen eingehalten werden. Die Durchführung erfolgt durch einen Fachbetrieb, der die Heizlast jedes Raums berechnet und die Ventile entsprechend einstellt.
Der Abgleich ist zudem Bestandteil vieler Förderprogramme und kann als energetische Sanierungsmaßnahme geltend gemacht werden.
 Bild: freepik.com/freepik
Bild: freepik.com/freepik
5. Thermostate voll aufdrehen
Damit das Heizsystem effizient arbeiten kann, sollten alle Thermostatventile vollständig geöffnet werden. Die Wärmepumpe passt ihre Leistung automatisch an die gemessene Rücklauftemperatur an. Eine gedrosselte Ventilstellung führt dazu, dass der Rücklauf unnötig warm bleibt, was den Taktbetrieb erhöht und die Effizienz senkt.
Besonders in vermieteten Wohnungen mit Einzelraumregelung ist es sinnvoll, Mieter über diese Funktionsweise zu informieren. Ein dauerhaft geöffnetes Thermostat bedeutet keine Überhitzung, sondern ermöglicht der Wärmepumpe eine gleichmäßige und energiesparende Betriebsweise.
Fachbetrieb einbeziehen
Für die Abstimmung aller Komponenten ist die Unterstützung durch einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb empfehlenswert. Dieser kann nicht nur die technischen Einstellungen vornehmen, sondern auch mögliche Schwachstellen im System aufdecken.
Auch im Hinblick auf die Betriebskostenabrechnung kann die fachgerechte Einstellung Vorteile bringen. Effizient eingestellte Anlagen sorgen für eine transparente Kostenstruktur und reduzieren das Risiko von Mieterreklamationen bei ungleichmäßiger Wärmeverteilung.